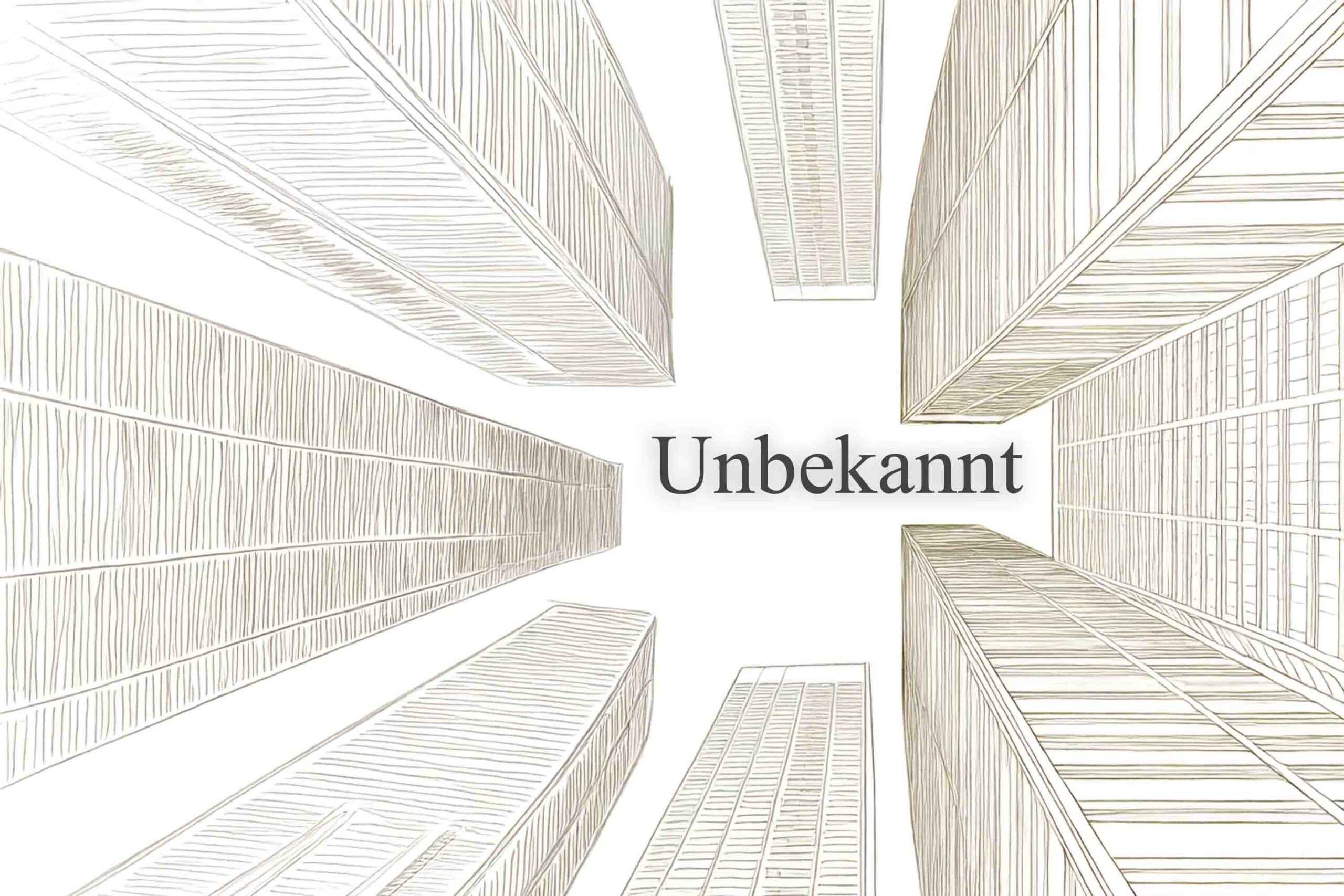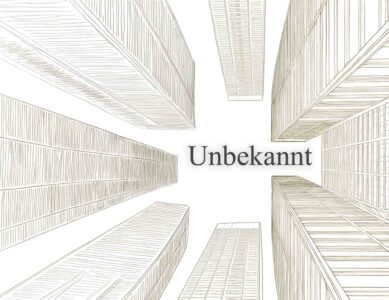Zwei Kapitel aus meinem neuen Buch – für euch und für einen guten Zweck
Dieses Buch ist für mich kein Projekt, um selbst Gewinn zu erzielen. Mein Wunsch ist es, euch ein paar nachdenkliche Momente zu schenken – und am Ende Kindern und Jugendlichen in Japan eine warme Nacht, Schutz und Sicherheit.
Ich schenke euch heute ein Kapitel und ein Nachrauschen aus meinem neuen Buch. Es ist kein Versuch, euch zu überreden, sondern eine Einladung, meine Gedanken zu lesen, die Geschichten zu fühlen und die Botschaft aufzunehmen. Gleichzeitig ist es aber eine Möglichkeit, etwas Gutes zu tun: 100% der Erlöse aus dem Buchverkauf gehen an das japanische bond Project, das jungen Menschen hilft, die Gewalt und Missbrauch erfahren haben.
Ihr könnt das Kapitel lesen, euch berühren lassen – und wenn ihr möchtet, das Buch erwerben. Jeder Kauf wird zu Hilfe, Hoffnung und einem Schritt, der direkt etwas bewirkt. Für mich ist dieses Buch ein Weg, geben zu können, etwas weiterzugeben – ein kleines Stück Liebe in die Welt zu tragen.
Kapitel 15
Ihr Lachen vermischte sich mit dem schrillen Summen der Grillen, die in den Blumenfeldern saßen. Ein grotesker Kontrast. Ein Geräusch, das in einer anderen Welt hätte friedlich klingen können. Aber nicht hier. Hier war es einfach nur hässlich.
Ein Schlag traf meine Schulter. Ich zuckte nicht einmal. Ein weiterer folgte, härter, gefolgt von einem Tritt gegen meine Rippen. Ich rollte mich ein, versuchte mich klein zu machen, als könnte ich einfach verschwinden, wenn ich mich nur eng genug zusammenkauerte. Aber es brachte nichts. Mein Körper hatte längst gelernt, den Schmerz zu ertragen, ihn dumpf werden zu lassen, wie eine Mauer, die ich um mich errichtet hatte. Doch irgendwann fällt auch die stärkste Mauer. Der nächste Tritt traf mich seitlich am Kopf. Ein scharfer Schmerz zuckte durch meinen Schädel, ein stechendes, grelles Aufleuchten in meinem Bewusstsein – dann wurde alles schwarz. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis ich wieder zu mir kam. Die Kälte war das Erste, das ich spürte. Der harte Beton unter mir, feucht vom Regen, der früher am Tag gefallen war. Mein Körper fühlte sich schwer an, wie eine leere Hülle, die mir nicht mehr gehörte. Ich blinzelte. Über mir erstreckte sich der Himmel, wolkenverhangen und unendlich.
Für einen Moment war es friedlich. Dann hörte ich es. Hämisches Gelächter. Es kam aus der Ferne, von oben. Mein Blick wanderte zu den Fenstern der Klassenräume. Sie standen dort, in den beleuchteten Räumen, sahen herab, beobachteten mich, als wäre ich nichts weiter als eine Szene in einem schlechten Film. Ihre Gesichter waren verzerrt vor Freude, ihre Finger auf mich gerichtet.
Die ganze Szenerie war ein Schauspiel in ihrem Stück. Die Schule war unsere Bühne. Und ich? Ich war die Figur, die man treten, verspotten, mit Getränkeresten übergießen, erniedrigen und dann achtlos liegen lassen konnte. Nicht mehr als ein wertloses Stück Papier im Wind.
Langsam, gekrümmt vor Schmerzen, schleppte ich mich den Weg nach Hause entlang. Meine Beine fühlten sich an, als würden sie jeden Moment unter mir nachgeben. Der süße, klebrige Saft tropfte mir noch immer aus den Haaren und rann mir in den Nacken. Ich spürte die Blicke der Passanten auf meiner Haut, sie brannten wie kleine Nadelstiche. Ich hörte ihr leises Flüstern – ein Murmeln, das mir lauter vorkam als jedes Geschrei. Schau dir die mal an. Ich schnappte den Satz zwischen all den Stimmen auf.
Ja, sieh genau hin, wie es mir geht. Sieh es dir an – und ignoriere mich trotzdem, raste ein wütender Gedanke durch meinen Kopf. Ich fühlte mich wie ein Fleck, den alle zu übersehen versuchten. Für einen Moment wollte ich schreien. Nicht, weil ich glaubte, jemand würde zuhören – sondern weil der Schmerz in mir wie ein Sturm gegen verschlossene Türen tobte. Aber selbst mein Schrei blieb in der Kehle stecken, verschluckt von einer Welt, die nie für mich bestimmt war. Ich war müde. Müde davon, wütend zu sein. Müde, überhaupt noch etwas zu empfinden. Vielleicht war das der Moment, in dem ich begriff, dass Wut nur ein letzter Versuch ist, sich gegen das Unausweichliche zu stemmen.
Es waren vielleicht noch hundert Meter, die zwischen mir und meinem Elternhaus lagen. Hundert Meter bis zu dem Ort, an dem nie jemand gefragt hat, wie es mir geht. Hundert Meter bis zu dem Fenster, hinter dem nie ein Licht brannte, wenn ich zu spät nach Hause kam. Meine Beine bewegten sich wie von selbst, aber sie wussten längst, dass sie nicht dort ankommen würden. Die Kälte kroch mir unter die Haut. Sie gefror fast unter meiner durchtränkten Bluse, schnitt wie Nadeln durch meine Gedanken. Ich ließ mich am Geländer der Brücke nieder. Der Beton unter mir war feucht, rau, und doch fühlte ich ihn kaum noch.
Heute Morgen hatte ich mit zitternden Gedanken die letzten Zeilen auf meinen Brief geschrieben. Ein weißer Umschlag liegt auf meinem Bett. Wartet. Vielleicht auf meine Eltern. Vielleicht auf niemanden.
Ich ertrage diese Hölle keinen Tag länger. Und wenn ich gehe, dann nicht, weil ich es wollte – sondern weil ihr mich dazu gebracht habt.
Ich weiß nicht, ob ich sterben will. Ich weiß nur, dass ich so nicht weiterleben kann. Noch einmal schaue ich hinunter. Das Wasser glitzert schwach im Licht der Straßenlaternen. Es wirkt friedlich, fast einladend. Dort unten gibt es keine Namen mehr, keine Stimmen, kein Lachen auf meine Kosten. Ich denke an den Sahnebecher. An das letzte Mal, als ich schwach war. An das letzte Mal, als ich kurz glaubte, ich könnte mir etwas Gutes tun. Aber dieser Moment ist vorbei. Ich hebe den Blick. Niemand ruft meinen Namen. Niemand kommt.
Ich habe niemandem etwas weggenommen – ich gehe nur dorthin, wo ich niemandem mehr zur Last falle. Ein letztes Mal nahm ich die wenige Kraft, die noch in mir ruhte zusammen. Die nasse Kleidung zog mich fast zurück zu Boden. Doch ich stemmte mich dem Lauf des Lebens entgegen, ich brach aus dieser Spirale aus. Den Weg bis ganz nach unten, schaffe ich schneller ohne die Erniedrigungen, ohne die beißenden Worte und das Gelächter. Meine Hände ließen all das los und dann war ich frei.
Es waren nicht ihre eigenen Hände, die mich in den Tod trieben – aber es waren ihre Taten, die mich von der Brücke stießen.
Nachrauschen
Es war kein Unfall und auch kein tragisches Missverständnis. Kein plötzlicher Moment, in dem alles zu viel wurde. Es war ein langer, qualvoller Weg, gepflastert mit Schweigen, mit Gleichgültigkeit, mit nahezu systematischer Demütigung. Ein Weg, den niemand hätte gehen dürfen. Ein Weg aus emotionaler Ausbeutung, aus Angst und seelischer Zerstörung. Tag für Tag. Lautlos. Grausam. Unterschätzt.
Was viele noch immer schlicht Mobbing nennen – als wäre es ein notwendiger Teil des Erwachsenwerdens – ist längst zu etwas anderem geworden. Es ist nicht mehr die harmlose Schulzeit, in der ein paar Sticheleien dazugehören. Kein flüchtiger Streit auf dem Schulhof. Keine neckische Bemerkung, kein kindlicher Konflikt. Es ist Folter. Und sie geschieht täglich – still, gezielt, oft unbemerkt. Hinter den Mauern von Schulen und Universitäten, jenen Orten, die eigentlich Schutz und Bildung versprechen. Orte, an die man später mit einem Lächeln zurückdenken sollte. An Tage voller Leichtigkeit, voller Freundschaft und Lebensfreude.
Doch für viele junge Menschen sind genau diese Orte nichts als ein Albtraum. Und dieser Albtraum beginnt nicht mit einem lauten Knall, sondern leise. Mit Worten. Mit Blicken. Mit Ausgrenzung. Und er entfaltet sich unaufhaltsam – still, präzise, erbarmungslos. Zu einem System aus psychischem und physischem Missbrauch. Es sind nicht mehr nur kleine Kränkungen. Es sind Angriffe. Echtes Leid. Mit blutenden Knien und gebrochenen Rippen. Mit Uniformen, die getränkt sind von Scham. Mit Tränen, die im Dunkeln geweint werden, damit niemand sie sieht. Mit Narben – außen und innen –, die nie mehr verschwinden. Und mit einer Einsamkeit, die alles andere lautlos verschluckt.
Ich spreche von jungen Menschen, die eigentlich lernen sollten, was Hoffnung bedeutet – und stattdessen erfahren, was es heißt, systematisch gebrochen zu werden. Nicht auf einmal. Sondern in tausend kleinen Schritten. So leise, dass selbst die engsten Freunde irgendwann nicht mehr hören, wie laut es in diesen Seelen schreit. Es ist kein Spiel. Kein Scherz. Es ist Misshandlung. Verübt von anderen jungen Menschen – oft gedeckt durch Schweigen. Oder durch Erwachsene, die sich mit Sätzen wie Da mussten wir alle durch aus der Verantwortung stehlen.
Sie werden angespuckt, ausgenutzt, geschlagen und getreten. Gezwungen, sich klein zu machen. Hören täglich, dass sie wertlos sind. Dass es besser wäre, wenn sie nicht existierten. Dass ihr Lächeln falsch ist, ihre Kleidung peinlich, ihr Körper hässlich. Jeder Satz ein Schnitt. Jeder Tritt eine Bestätigung. Und niemand hält sie auf. Und es wird schlimmer. Die Gewalt hat ein unvorstellbar großes Ausmaß angenommen. Ja, es sind Kinder und Jugendliche, Mitschülerinnen und Mitschüler. Vielleicht ist es schwer zu glauben. Vielleicht will man es nicht glauben. Doch die körperliche Gewalt geht weit über Schläge und Tritte hinaus. Bis Blut fließt. Bis bleibende Narben den eigenen Körper zeichnen. Wunden, so groß, dass man sie im Krankenhaus behandeln lassen müsste – doch stattdessen wartet Leistungsdruck. Und die Angst, als schwach zu gelten, versagt zu haben!
Niemand – wirklich niemand – sollte lernen müssen, mit gebrochenem Herzen stillzuhalten. Mit zitternden Händen einen Geigenbogen zu führen, während die Rippen vom Vortag schmerzen – noch immer gebrochen sind. Niemand sollte sich bedanken müssen für eine Zukunft, die man sich jeden Tag aus dem eigenen Fleisch schneiden muss.
Diese Gewalt findet statt – jeden Tag. Nicht in der Fantasie. Nicht in einem Film. Nicht in einer überzeichneten K-Drama-Serie. Sie ist Realität. Und niemand darf sich mehr herausnehmen zu sagen, das sei normal. Dass Kinder eben grausam seien. Dass das schon dazugehöre. Nichts davon gehört dazu. Kein Kind, kein junger Mensch, kein Mensch überhaupt sollte jemals durch solch eine Hölle gehen müssen. Doch zu viele sehen weg. Obwohl sie es sehen – oder sehen könnten, wenn sie wollten. Lehrkräfte schweigen, um ihren Ruf zu wahren. Um den Namen der Schule zu schützen. Und das Umfeld – es schweigt mit. Still. Tatenlos. Während ein Mensch täglich vor ihren Augen zerbricht. Wer aber wirklich hinsieht, erkennt die Wahrheit. Den Menschen, der sich jeden Morgen aus tausend Splittern zusammenklebt. Der lacht, obwohl das Lachen längst nicht mehr ihm gehört. Der still wird – nicht aus Ruhe, sondern aus Resignation. Und dann? Dann bleibt nicht mehr viel. Dann beginnt das innere Verstummen.
Und all das geschieht in Gesellschaften, die Menschen zu Zahnrädern machen. Die Leistung fordern – von klein auf. Lernen. Funktionieren. Perfekt sein – mit einem Lächeln. Und nach dem Unterricht? Da warten die Musikschule, die Nachhilfe, der Sportclub. Doch was bleibt von einem Kind, das nie Kind sein durfte? Was bleibt, wenn Lob nur dann existiert, wenn die Zahlen stimmen? Wenn Noten wichtiger sind als Narben?
Wir reden oft über Mobbing, als wäre es eine unvermeidliche Etappe des Erwachsenwerdens. Ein blauer Fleck, der heilt. Ein Wort, das vergessen wird. Doch das, was hier geschieht, ist keine Kleinigkeit. Es ist keine Randnotiz des Schulalltags. Kein Test der Belastbarkeit unter Gleichaltrigen. Es ist Gewalt. Still oder schreiend, sichtbar oder verborgen – aber immer real. Und sie trifft junge Menschen in einem Alter, in dem Vertrauen wachsen sollte, nicht zerbrechen. Besonders in jenen Kulturen, in denen das Zeigen von Schwäche gleichgesetzt wird mit persönlichem Versagen, wird diese Gewalt unsichtbar gemacht. Verharmlost. Ausgeblendet. Doch sie ist da – und sie hinterlässt Spuren, die tiefer reichen, als es je ein blauer Fleck könnte.
Wer tagtäglich solch eine Hölle durchlebt und gleichzeitig die Gleichgültigkeit vieler spürt, verliert nicht nur das Vertrauen in andere – sondern oft auch in sich selbst. In das eigene Lebensrecht. Und irgendwann ist es kein Gedanke mehr, sondern eine Entscheidung. Eine Tür, die sich schließt, weil niemand rechtzeitig hineingeschaut hat.
Ich war dort. Ich habe gesehen, was geschieht, wenn ein junger Mensch die Farben seines Lebens mit Schwarz übermalt. Gerade einmal siebzehn Jahre jung. Vierzehn Stockwerke tief. Es war kein Unfall. Kein impulsiver Moment. Es war der letzte Schritt eines Weges, den dieser Mensch nie hätte gehen dürfen. Kein Aufbäumen. Kein Brief. Kein letzter Blick. Nur ein letzter Schritt – weil es keinen anderen mehr gab. Weil sie – eine Schülerin, ein junges Leben – es nicht mehr aushalten konnte. Weil ihre Kraft aufgebraucht war. Nicht, weil sie schwach war – sondern weil sie viel zu lange stark sein musste. Stark genug, um sich jeden Tag aus Scherben zusammenzusetzen. Stark genug, um zu funktionieren, zu lächeln, nicht aufzufallen. Stark genug, um zu überleben, obwohl das Leben längst zu viel war.
Was ihr fehlte, war nicht Mut. Was ihr fehlte, war ein Mensch. Jemand, der geblieben wäre. Der nicht weg-, sondern hingesehen hätte. Der ihre Stille als Hilferuf erkannt hätte. Und es war genau dieser Moment – dieser Sprung, dieses Verstummen –, der Auslöser für dieses Buch war.
Der Moment, an dem klar wurde: Ich kann die Welt nicht verändern. Aber ich kann aufhören, wegzusehen.
Diese Menschen sind nicht das Echo ihres letzten Schrittes. Sie sind keine Schlagzeile. Kein tragischer Einzelfall. Sie waren Leben – voller Geschichten, voller Sehnsucht, voller Hoffnung. So wie du. So wie ich. Es darf nicht immer und immer wieder geschehen. Und schon gar nicht so lautlos.
Doch das Bitterste war vielleicht nicht die Tragödie selbst, sondern die Art, wie man sie hinnahm – als wäre sie längst Teil der Normalität. Wie still es danach wurde. Fast so, als hätte sich nichts verändert. Kein Aufschrei. Keine echten Fragen. Als wäre sie bloß eine weitere Zahl in einer traurigen Statistik. Eine Randnotiz unter vielen. Ein Fall, wie es ihn schon oft gegeben hat – und der bald wieder vergessen sein würde.
Doch sie war kein Fall. Kein Nebensatz. Kein Schatten, den man überliest. Sie war ein Mensch. Ein Leben, das nicht einfach hätte verschwinden dürfen. Sie war ein Schrei – ein stummer, endloser Schrei, der durch die Mauern unserer Gleichgültigkeit drang. Und wir? Wir hörten ihn nicht. Oder wollten ihn nicht hören. Und genau das ist die wahre Tragödie.
Und ich frage mich: Warum hören wir erst zu, wenn es zu spät ist? Warum sehen wir nicht hin – sondern hinterher, was hätte sein können?
Unbekannt
Erschienen ist das Buch im Books on Demand Verlag und es ist unter dem Titel Unbekannt, der ISBN 978-3-8192-9906-3 oder über die nachfolgenden Links zu finden.
Natürlich kannst du es auch ganz klassisch in deiner Lieblingsbuchhandlung bestellen – offline in der echten Welt oder ganz bequem online.
Bezugsquellen – Paperback & eBook
Bestelle direkt beim Verlag und spare dir den Versand
Books on Demand
Alles wie gewohnt – sogar als eBook-Version
Amazon
In deiner Buchhandlung in der Nähe bestellen
Thalia Buchhandlung